

Innerhalb der Befragten mit niederländischen Vorfahren unterscheiden sich die Einstellungen und Ernährungsgewohnheiten der beiden Geschlechter relativ wenig. Männer und Frauen übernehmen beinahe zu gleichen Teilen die Verantwortung für das Einkaufen und das Kochen von Mahlzeiten. Die Männer in dieser Gruppe bevorzugen – verglichen mit Männern in den beiden anderen Gruppen – eher geringe Fleischportionen und sind überdies stärker bereit, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Zudem verzehren sie häufig Fleischersatzprodukte. Die traditionelle Verbindung zwischen Fleischkonsum und Männlichkeit scheint bei den Kindern von gebürtigen Niederländern nicht mehr so stark ausgeprägt zu sein.
Anders verhält es sich bei den Nachkommen türkischer Einwanderer. Sie erklären fast alle, keine Fleischersatzprodukte zu konsumieren. Zudem zeigen die Männer in dieser Gruppe eine Vorliebe für einen signifikant höheren wöchentlichen Fleischverzehr. Sie lassen nur eine schwache Bereitschaft erkennen, im Interesse der Umwelt oder der Tiere auf Fleisch zu verzichten. In diesen beiden Punkten unterscheiden sie sich deutlich von türkischstämmigen Frauen.
Die Kinder chinesischer Einwanderer bilden gleichsam das Mittelfeld zwischen beiden Gruppen. Die Vorliebe für große Fleischportionen ist unter ihnen weniger stark ausgeprägt, und sie zeigen eine größere Bereitschaft, ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Adipositas ist bei den Männern in dieser Gruppe deutlich seltener anzutreffen als bei den Kindern von türkischstämmigen Einwanderern.
Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass kulturelle Traditionen und ethnische Zugehörigkeiten einen nicht zu unterschätzenden Einfluss darauf hätten, was innerhalb der Bevölkerung eines Landes als ‚typisch männlich' gelte. Sie würden sich dadurch auch auf das Ernährungsverhalten der Menschen auswirken, was sich am Beispiel des Fleischkonsums deutlich nachweisen lasse, erklärt Dr. Schösler. Man solle sich allerdings hüten, auf der Basis solcher Resultate zu vorschnellen Beurteilungen des Essverhaltens zu kommen, denn die kulturellen Unterschiede seien tiefgreifend. In der türkischen Küche würden beispielsweise viel mehr Hülsenfrüchte, wie etwa Linsen oder Kichererbsen, gegessen. Diese seien als Fleischersatz sehr gut geeignet, würden allerdings in der türkischen Kultur nicht unbedingt als solcher wahrgenommen. Auch sei das Tierwohl durch die islamischen Speisevorschriften viel stärker in der Esskultur verankert, als dies in der westlichen Tradition der Fall sei.
Mit der Studie wolle man vor allem darauf aufmerksam machen, dass gesundheitspolitische Kampagnen, die auf ein gesünderes Ernährungsverhalten abzielen, kulturell bedingte Verhaltensmuster immer mitberücksichtigen müssten, fügt Dr. Schösler hinzu. Denn wenn tradierte Vorstellungen bezüglich eines ‚typisch männlichen' Fleischkonsums und eine große Auswahl preiswerter Fleischprodukte in europäischen Industrieländern aufeinander treffen würden, könne dies den Erfolg solcher Kampagnen behindern.
Die Bayreuther Ernährungswissenschaftlerin koordiniert an der Universität Bayreuth das Profilfeld „Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften" und ist an der Konzeption des gleichnamigen Masterstudiengangs beteiligt, der zum Wintersemester 2015/16 an der Universität Bayreuth startet. In diesem Studiengang werden Aspekte einer gesunden Ernährung und deren gesellschaftliche Voraussetzungen eine zentrale Rolle spielen.
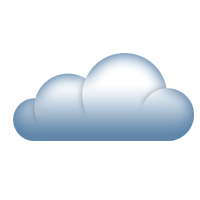 | Stark bewölkt 18 / 20° C Luftfeuchte: 90% |
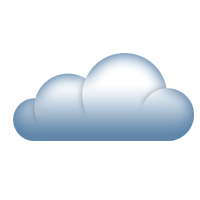 | Stark bewölkt 18 / 20° C Luftfeuchte: 87% |
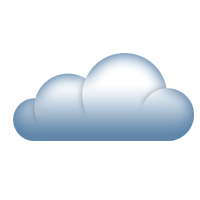 | Stark bewölkt 17 / 18° C Luftfeuchte: 88% |