


Eltern nehmen kindliche Signale wie Gesten, Mimik und Laute wahr, interpretieren sie intuitiv und reagieren entsprechend im Sinne des Kindes. Müttern, die in ihrer eigenen Kindheit Missbrauch, Misshandlungen oder Vernachlässigung erlebt oder andere schlimme Erfahrungen gemacht haben, fällt dies oft schwerer bzw. es kostet sie mehr Anstrengung als unbelasteten Eltern.
Will man geeignete Hilfsangebote für betroffene Eltern entwickeln und die „Übertragung" belastender Lebenserfahrungen auf die Kinder unterbrechen, muss man zunächst verstehen, wie dies zustande kommt. „Dieses erweiterte Verständnis wird auch zu einer Optimierung unserer bestehenden Hilfsangebote führen" erläutert Professor Franz Resch, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Heidelberg.
Von Heidelberg aus wird ein Verbundprojekt koordiniert unter dem Titel „Von Generation zu Generation: Den Kreislauf der Misshandlung verstehen und durchbrechen (Understanding and Breaking the Intergenerational Cycle of Abuse, UBICA)".
„Unser Ziel ist es, langfristige Auswirkungen belastender Kindheitserfahrungen besser zu verstehen – insbesondere in Hinblick auf die Elternrolle der Betroffenen. Wir wollen helfen, Strategien zur Bewältigung und Prävention zu entwickeln, um Eltern sinnvoll zu unterstützen und Kinder besser zu schützen", sagt Professor Romuald Brunner, Stellvertretender Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Heidelberg und UBICA-Koordinator.
Das multizentrische Projekt mit vier Verbundpartnern wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 2 Millionen Euro gefördert. Aus Heidelberg beteiligen sich Teams der Universitätsklinik für Allgemeine Psychiatrie und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Unterstützung für Teenager-Mütter
Konkrete Schritte hin zur praktischen Anwendung geht man z.B. bereits am Universitätsklinikum der RWTH Aachen mit einem Betreuungsangebot für Teenager-Mütter, die durch die frühe Schwangerschaft einer großen Belastung ausgesetzt sind: Sie haben zum Zeitpunkt der Geburt noch keinen Schulabschluss, sind finanziell abhängig, ihre Zukunft ist ungewiss. Im Rahmen einer Interventionsstudie (Teenage Mothers-Studie) besuchen Psychologen die jungen Mütter zu Hause, filmen deren Interaktionen mit ihren Babys und besprechen sie anschließend mit ihnen. So erhalten die Mädchen konkrete Tipps, wie sie feinfühliger und souveräner mit ihren Kindern umgehen können. Erste Ergebnisse aus Vergleichen mit Mutter-Kind-Paaren, die kein solches Coaching erhalten sind sehr vielversprechend.
Depressionen bei Müttern behandeln
Traumatische Kindheitserlebnisse der Mütter allein beeinflussen allerdings den Umgang mit dem Nachwuchs weniger als bisher gedacht, wie ein gemeinsames Teilprojekt der Universitätskliniken Heidelberg und der Berliner Charité nun gezeigt hat. Vielmehr erhöhen Depressionen der Mütter das Risiko, dass diese weniger sensibel auf kindliche Signale reagieren und die Kinder in Folge Verhaltensauffälligkeiten entwickeln. Wer allerdings in seiner Kindheit Misshandlungen ausgesetzt war bzw. vernachlässigt wurde, trägt wiederum ein höheres Risiko, eine Depression zu entwickeln. „Trotzdem sind diese Ergebnisse ein positives Signal für betroffene Mütter, denn Depressionen lassen sich sehr gut behandeln", erklärt Professor Bermpohl.
Eine wichtige Rolle spielt auch das Beziehungshormons Oxytocin. Das Hormon, das bei der Geburt in großen Mengen ausgeschüttet wird, fördert die Bindung von Mutter und Kind und sorgt dafür, dass sich beide Organismen aufeinander einstellen. Forscher sprechen von einer sozialen Synchronizität, die sich sowohl in molekularen Prozessen im gesamten Körper, in Hirnfunktionen, als auch im Verhalten der Bindungspartner widerspiegelt. Dieses empfindliche System kann durch traumatische Erlebnisse in der Kindheit oder durch Depressionen gestört werden.
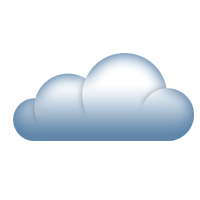 | Stark bewölkt 1 / 4° C Luftfeuchte: 89% |
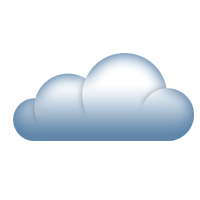 | Bedeckt 6 / 8° C Luftfeuchte: 73% |
 | Bewölkt 0 / 0° C Luftfeuchte: 89% |