


Insgesamt 11 Krankenhäuser in Sierra Leone hat Gisela Schneider auf ihrer Reise in das westafrikanische Land besucht. Nur in dreien wurden Patienten fortlaufend behandelt. Grund dafür ist die Schließung der Krankenhäuser auf Grund der Ansteckungsgefahr für die Mitarbeitenden mangels ausreichendem Schutzmaterial. Auch sind etwa 221 Gesundheitsmitarbeitende in Sierra Leone in den vergangen Monaten an Ebola gestorben. Dr. Schneider erzählt, warum es so weit kommen konnte.
Ebola hätte sich deshalb sich so gut ausbreiten, weil das Gesundheitssystem, die Krankenhäuser gar nicht in der Lage gewesen wären, damit überhaupt umzugehen. Patienten kämen einfach rein, würden nicht erkannt, und würden von den Mitarbeitenden berührt. Die Hygienevorrichtungen wären nicht so wie sie hätten sein sollen. Und deshalb würden sehr viele Gesundheitsmitarbeiter infiziert.
Die Difäm-Direktorin war in vielen Städten Sierra Leones unterwegs. In der Hauptstadt Freetown, ebenso wie in Port Loko oder Lunsar. Angst, sich selbst mit dem Virus zu infizieren, hatte sie trotz häufiger Kontakte mit den Einheimischen nicht.
Sie hätte Respekt und deshalb auch Vorsichtmaßnahmen getätigt. Vor allem Hände-waschen, no touch, also kein Hände-schütteln, kein Sich-Umarmen oder irgendetwas in dieser Richtung. Und wenn man sich an diese Dinge hielte, sei man eigentlich relativ sicher. Sie wüsste ja: sie könne sich nur dann infizieren, wenn sie mit der Körperflüssigkeit eines Kranken in Berührung käme. Und wenn sie das verhindere, dann könne sie sich auch nicht infizieren. Dann brauchte sie auch keine Angst zu haben.
Doch gerade das ist in afrikanischen Kulturen nicht immer zu vermeiden, wo häufig viele Menschen auf engen Raum zusammenleben. Die Unsicherheit dort ist riesig – auch, weil die Epidemie immer noch aktiv ist, so Schneider weiter.
Man würde immer wieder daran erinnert, wenn dann eine Ambulanz mit Sirene durch die Stadt führe. An einem Tag hätte sie zehn von den Ambulanzen gehört. Dann wüsste man, dass die Epidemie wirklich immer noch am Laufen sei, man müsse immer noch die Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Das fiele der allgemeinen Bevölkerung aber schwer. Sie seien müde von der langen Zeit, wo es hieße: berührt euch nicht, keine Massenveranstaltungen und ähnliches. Und es sei der große Wunsch zurückzukehren zur Normalität.
Damit das gelingen kann, müssen vor allem die Gesundheitseinrichtungen in Sierra Leone, die erst nach und nach wieder ihre Arbeit aufnehmen, bestmögliche hygienische Standards erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel die Einführung einer Infektionskontrolle. Viel Aufbauarbeit sei laut Gisela Schneider dort jetzt notwendig.
Eine wichtige Lehre sei, dass man auf einer Welt lebte. Dass es einem nicht egal sein könne, was in Afrika passierte. Deshalb glaubte sie, dass sie dort ihre Verantwortung auch annähmen. Und jetzt müssten sie versuchen nach der humanitären Katastrophe weiter dran zu bleiben, eben nachhaltig auch besser Gesundheitssysteme aufzubauen.
12 Tage lang bis zum 9 Februar war Dr. Schneider in Sierra Leone. Erst nach 21 Tagen ist keine Untersuchung auf eine mögliche Infizierung mehr nötig. Dann besteht die Gefahr einer potenziellen Ansteckung nicht mehr.
Die humanitäre Hilfe vor Ort geht aber weiter. Offiziell ist die Epidemie erst beendet, wenn 42 Tage lange kein neuer Ebola- Fall gemeldet worden ist.
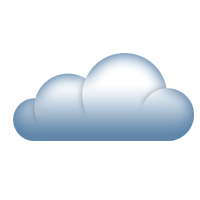 | Bedeckt 4 / 8° C Luftfeuchte: 76% |
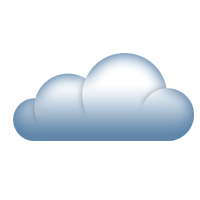 | Bedeckt 4 / 8° C Luftfeuchte: 76% |
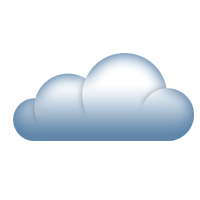 | Bedeckt 3 / 7° C Luftfeuchte: 88% |